Wohlfahrtsmix und Steuerungsmix bei den Sozialen Diensten
Artikel vom 04.11.2002
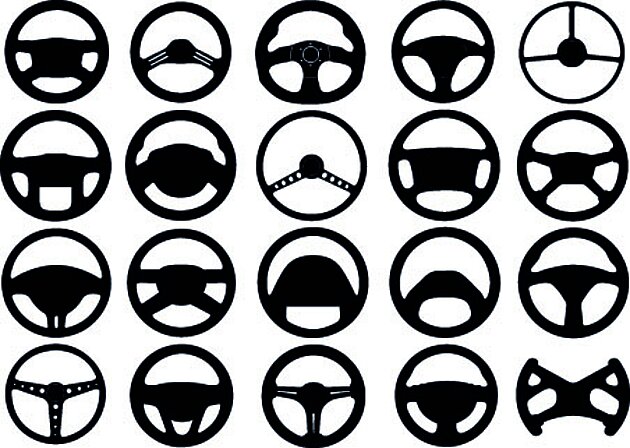
Die Sozialen Dienste nehmen in der Debatte um die Daseinsvorsorge eine Sonderstellung ein. Die Ausgangslage ist komplex, da im Sozialbereich die unterschiedliche und zunehmend miteinander konkurrierende Trägerschaft - Freie Wohlfahrtspflege, gewerbliche Unternehmen und Einrichtungen der Kommunen - für die derzeitige Struktur prägend ist. Bei einzelnen der angebotenen sozialen Dienstleistungen stellt sich grundsätzlich die Frage der Marktfähigkeit. Auf der anderen Seite kann eine Liberalisierung für alle beteiligten Organisationen und Unternehmensformen Vorteile bringen. Von Kirsten Mensch
Die derzeitige Struktur der Sozialen Dienste
Grundsätzlich begrüßen Experten den in letzter Zeit entstandenen Wohlfahrtsmix aus privaten Trägern, Trägern der Freien Wohlfahrtspflege und der Kommune. Der Einbruch des Privaten in die früher oftmals nur von Kommune und Freier Wohlfahrtspflege besetzten Felder bringt aus ihrer Sicht neue Ideen und auch Geld in den Sozialbereich. Wenn sich die Proportionen im Wohlfahrtsmix mehr zugunsten der privaten Dienstleister verschöben, wäre es nach Meinung privater Träger noch besser. Wie sie geltend machen, trägt zur Zeit die öffentliche Regulierung zur Verhinderung privater Trägerschaft bei. So bekämen, unabhängig vom gebotenen qualitativen Standard, private Unternehmen nur dann den Zuschlag, wenn sie günstiger seien als die Freie Wohlfahrtspflege. Dadurch hätten private Anbieter in einigen Bundesländern keinerlei Chance.
Damit Wohlfahrtsmix und Wettbewerb entstehen, ist eine auskömmliche Finanzierung Voraussetzung. In Sozialen Diensten wie Beratungsleistungen, der ambulanten Jugendhilfe, Kindertagesstätten, telefonischer Seelsorge und ähnlichen, die nicht ausreichend finanziert und daher nach wie vor von nicht-gewerblich orientierten Trägern angeboten werden, kommt kein Wettbewerb zustande.
Wo hingegen die rechtlichen Rahmenbedingungen eine ausreichende Finanzierung sichern, wie zum Beispiel bei der Pflegeversicherung, wird eine weit fortgeschrittene Entwicklung der Ökonomisierung festgestellt. So hat sich in letzter Zeit die Zahl privater ambulanter Pflegedienste in Hessen stark erhöht.
Dass private Träger Kindertagesstätten führen, so wird geäußert, verhindern die Städte. Zur Zeit übernimmt die Kommune 95 Prozent der Kosten, fünf Prozent verbleiben bei dem Träger. Die Träger der Freien Wohlfahrtspflege übernehmen diese Kosten „gerne“, da sie so Probleme mit dem Finanzamt umgehen. Sicherte hingegen die Stadt eine Kostendeckung von 100 Prozent zu, wäre eine Privatisierung auch von Kindertagesstätten denkbar. Kritische Stimmen fragen, warum Kommunen manche Aufgaben wie etwa Beratungsstellen, die interessierte Bürger über die Angebotspalette Sozialer Dienste informieren, an sich ziehen und nicht an private Anbieter vergeben.
Übereinstimmend gelten die Rahmenbedingungen als ausschlaggebend für Wettbewerb und Privatisierung. Bestünde analog zur Pflegeversicherung eine „Kita-Versicherung“, gäbe es in der Kinderbetreuung den gleichen Wohlfahrtsmix.
Was soll sich ändern?
Der Trend zu Ökonomisierung und Privatisierung in den Sozialen Diensten ist unverkennbar. Trotzdem hinterfragen Experten immer noch, warum wir Ökonomisierung und Privatisierung brauchen: „Liegen Qualitätsmängel vor? Oder entspringt der Wunsch nach Privatisierung einem allgemeinen Modernisierungsinteresse?“ Der Zwang zu effizientem Handeln, um
gesellschaftlich knappe Ressourcen zu sparen, muss demnach nicht im Gegensatz zu normativen Ansprüchen stehen.
Um alle Potentiale im Bereich sozialer Dienstleistungen auszuschöpfen, kommen mehrere Wege in Betracht: Erstens können die vorhandenen Mittel effizienter eingesetzt werden, indem man die zu vergebenden Aufgaben ausschreibt. Darüber hinaus ist zu klären, welches Spektrum von Angeboten marktfähig sein soll, für das man in Folge entsprechende Rahmenbedingungen schaffen muss. Und drittens soll die große Bandbreite der Konsumentensouveränität beachtet und genutzt werden. Der „Verweis auf Demenzkranke“ darf nicht zu Paternalismus in allen Fällen führen.
In weitgehender Übereinstimmung wird nicht ein reiner Kostenwettbewerb, sondern ein fachlich-qualitativer Wettbewerb für wünschenswert gehalten.
Keine Einigkeit ist in der generellen Beurteilung der Sozialpolitik in Deutschland festzustellen. Im Gegensatz zur Einschätzung, dass der deutsche Sozialstaat nicht ausufert, sondern ein Rückgang der Quote für Sozialausgaben erkennbar ist, halten andere die Sozialstaatsquote für zu hoch. Insbesondere im Vergleich zu der in den letzten Jahren gesunkenen Wirtschaftskraft Deutschlands gelten die Ausgaben für Sozialleistungen als nicht akzeptabel. Als problematisch wird gesehen, dass die Kosten der deutschen Sozialpolitik im europäischen Vergleich an der Spitzen liegen, die Abgaben jedoch nur mittleres Niveau erreichen. Wie Skeptiker zu bedenken geben, sind nicht nur Sozialleistungen zu finanzieren, sondern es ist auch eine angemessene Daseinsvorsorge in anderen Bereichen beizubehalten. Zwischen sozialpolitischer Daseinsvorsorge und Daseinsvorsorge in anderen Bereichen wird eine sorgsame Abwägung gefordert.
Ein Kritikpunkt am deutschen Sozialstaat und insbesondere am Bereich der Sozialen Dienste wird immer wieder laut: die vorherrschende Intransparenz. Festgestellt werden starke Unübersichtlichkeiten vor allem aufgrund langer Wege, der dezentralen Organisation, der Schichtung nach verschiedenen Kriterien, der deutschen Bundesstaatlichkeit und des herrschenden Paradigmas eines delegierenden Staates. Wegen der Intransparenz wird Nutzerautonomie kaum für möglich gehalten. Anspruchsberechtigte hätten oftmals mit fünf bis sechs verschiedenen Verwaltungen zu tun. Allenfalls wüssten einzelne Untergruppen über Rechte und Leistungsangebote ausreichend Bescheid, aber nicht alle potentiellen Nutzer. Ob man dieser Situation durch ein Beratungszentrum abhelfen kann, oder ob dies nur der Errichtung einer weiteren staatlichen Stelle gleichkommt, ohne dass sich am ausufernden System etwas ändert, wird kritisch hinterfragt.
Die Komplexität des deutschen Sozialstaats wird andererseits auch positiv gesehen. Durch sie entsteht eine hohe Pluralität, die Auswahlmöglichkeiten zulässt. In der Tat gilt das System als sehr elastisch, allerdings zum Preis nur erschwert möglicher Reformierbarkeit. So machen die großen Akteure aufgrund ihrer eigenen Interessen eine Vereinfachung der Regelungen im Sinne der Nutzer oftmals unmöglich.
Die Frage der Steuerung
Steuerung ist - so eine Meinung - zum einen nötig, um aus sozialen Gesichtspunkten Marktregulierungen zu ermöglichen, und zum anderen, um Bedarfsdeckung sicherzustellen. Die Gegenmeinung setzt eher auf Selbstregulierungskräfte des Marktes. In Kindergärten zum Beispiel braucht man aus dieser Perspektive keine externe Steuerung, sondern kann die Steuerung Eltern und Kindern überlassen. Vorgeschlagen wird auch, wie in anderen Bereichen der Sozialen Dienste, über ein Gutschein-System den Weg von der Investitionsförderung hin zur Subjektförderung einzuschlagen.
Gerade bei diesem Beispiel werden aber Gegenstimmen laut. Ohne Regulativ in der Subjektfinanzierung wäre es möglich, dass MacDonalds Kindergärten eröffnet, einmal pro Tag kostenlos Pommes frites anbietet und letztlich auch die Kindererziehung in den Händen hält. Auch die derzeit praktizierte Vergabe von Kindergartenplätzen, die eben nicht zentralisiert ist, bestätigt für manche die Nachteile der fehlenden Marktregulierung: Sie erkennen am Beispiel eines Stadtteils mit zwei kirchlich getragenen Kindergärten ohne ausländische Kinder und einem städtischen Kindergarten mit einem 60-prozentigen Anteil ausländischer Kinder deutlich einen Steuerungsbedarf.
Zudem wird Steuerung schon alleine daher für notwendig gehalten, weil man Plätze für den zukünftigen Bedarf planen muss. Die Realisierung von Plätzen etwa im Altenpflegebereich dauert fünf bis sechs Jahre. Der wachsende Wettbewerb in Verbindung mit rechtlichen Rahmenbedingungen wie dem Pflegegesetz hingegen höhlt Steuerungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand aus. Im Pflegebereich kommt es aufgrund der gesicherten Finanzierung durch die Pflegeversicherung zu einer Überkapazität an Pflegeplätzen.
Ein Vertreter der privaten Unternehmen greift dieses Argument mit anderem Akzent auf: Er berichtet, dass die privaten Unternehmen unabhängig von den bestehenden, niedriger angesetzten Altenpflegeplänen Pflegeheime errichten. Die entstehenden Plätze werden dann immer auch nachgefragt. Daraus schließt er, dass die öffentliche Planung nicht mit dem tatsächlichen Bedarf übereinstimmt. Doch - so die Gegenmeinung - genau hier liegt das Problem. Wie auch im Krankenhaussektor wird jedes Bett belegt. Statt fehlender sinnvoller Einrichtungen der Altenpflege, zum Beispiel ambulanter Betreuungsmöglichkeiten, werden renditeträchtige Heimplätze realisiert. Hier muss eine Steuerung einsetzen, die eine derartige volkswirtschaftliche Verschwendung verhindert.
Auch andere Beispiele zeugen davon, dass, sobald ein finanziertes Angebot besteht, die Nachfrage quasi automatisch eintritt. So werden etwa die in Hessen angebotenen Mittel für Kinder mit Legasthenie als kostenlose Hausaufgabenhilfe missbraucht. Gefragt wird nach einer Bedarfsdeckelung, die den immer wieder durch öffentliche Diskussionen oder veränderte Gesetzgebung neu erzeugten Bedarf im Zaum halten kann. Allerdings wurden auch schon vor der Ökonomisierung im Bereich der Sozialen Dienste Bedarfssteigerungen festgestellt. Kritiker fragen, wer denn die Kompetenz zur Bedarfsfeststellung habe: Das könnten doch nur die Nachfrager sein. Von anderer Seite wird darauf verwiesen, dass man „Bedarf“ auf zwei verschiedene Weisen verstehen kann - zum einen als Bedarf von Individuen, zum anderen als Bedarfe, die mit öffentlichen Geldern ausgestattet werden.
Wer soll die Steuerung übernehmen?
Dass die Kommune steuern solle, private und freie Träger die Leistungen ausführen sollten, wird von einem Teil der Experten befürwortet. Auch Servicestellen, die über das vorhandene Angebot Sozialer Dienste beraten, gehören aus dieser Sicht in kommunale Hand , um trägerspezifische Beratungstendenzen zu verhindern. Allerdings ist die städtische Verwaltung bislang mit zu wenig Mitarbeitern ausgestattet, die über eine entsprechende Ausbildung verfügen, um effektiv steuern und kontrollieren zu können.
Ein anderer Vorschlag zur Steuerung zielt auf die Bündelung vor Ort, gekoppelt mit Partizipation. Bedarfsfeststellung und Steuerung können demnach durch lokale Gremien erfolgen, die der Kooperation und Abstimmung zwischen allen dienen, die im entsprechenden Bereich tätig sind oder ihn nutzen. Um einer selektiven Partizipation zuvorzukommen, sei durch aufsuchende Strategien für alle Betroffenen eine Zugangsmöglichkeit zu schaffen. Dies wäre Aufgabe der kommunalen Steuerung. Ein weiterer Vorteil der Stärkung der Partizipation und des Empowerments von Bürgern wird darin gesehen, dass der „Druck von unten“ die Unbeweglichkeit der großen Organisationen und Bürokratien wie z.B. der Rentenversicherung abbauen kann. Eine systematische Vertretung der Bürger respektive Patienten kann eine Kooperation der großen Organisationen im Sinne der Nutzer erzwingen.
Als weiteres Steuerungselement wird Benchmarking genannt. Benchmarkingprozesse zwischen Kommunen existieren schon, doch durchgeführt, so die Feststellung, werden sie nur hinter verschlossenen Türen. Als Grund hierfür gilt die Angst, dass die in solchen Vergleichen gut abschneidenden Verwaltungsbereiche den Vorwurf bekommen, zu viel Geld auszugeben, und in Folge mit Mittelkürzungen zu rechnen haben. Zudem wird eine Veröffentlichung solcher Vergleiche für den Sozialstaat als desaströs eingeschätzt, da starke Unterschiede zwischen den Kommunen bestehen, die sich nicht durch entsprechend unterschiedliche Ausgangslagen der Gemeinden erklären lassen.
Auswirkungen des EU-Rechts
Die von vielen geäußerte Furcht vor der „Umwälzung des Sozialbereichs“ durch das EU-Recht halten Experten für unbegründet. Da der Wirtschaftsbereich der Sozialen Dienste zu geringfügig ist und ihre Leistungen selten grenzüberschreitend angeboten werden, greifen die EU-Regeln hier nicht. Nur wenn es um die Vergabe staatlicher Beihilfen geht, muss nach EU-Recht ausgeschrieben werden - und in diesem Falle dürfen ausländische Anbieter nicht benachteiligt werden. Eine Bewerbung ausländischer Anbieter im sozialen Dienstleistungsbereich kommt indes eher selten vor. Zudem sind Wettbewerbsbeschränkungen zulässig, wenn durch sie ein wichtiges öffentliches Interesse gewahrt werden kann.
Auch die oftmals in der Freien Wohlfahrtspflege stattfindenden Quersubventionierungen sind nur dann zu beanstanden, wenn eine EU-wettbewerbsrelevante Frage auftaucht, also der freie Träger zum Beispiel bei einer Ausschreibung in Konkurrenz tritt zu anderen Bewerbern und dabei versucht, ein durch Quersubventionierung ermöglichtes günstigeres Angebot zu unterbreiten.
Bislang - so das Fazit von Experten - bestehen keine relevanten Behinderungen der Sozialen Dienste durch das Wettbewerbsrecht der EU. Für relevanter hingegen werden die Möglichkeiten der europaweiten Expansion gehalten, die sich für einzelne Untergruppen in der Freien Wohlfahrtspflege eröffnen. Auch wenn es in den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege kein dezidiertes Leitbild in Richtung internationale Aktivitäten gibt, engagieren sich einzelne Mitglieder oder Untergruppen sicherlich im Ausland.
Folgen der Ökonomisierung für die Freie Wohlfahrtspflege
Die Freie Wohlfahrtspflege hat - wie Experten feststellen - in den letzten Jahren beinahe alle ihre Privilegien verloren, die sie im sozialen Dienstleistungsbereich genossen hatte. Übrig geblieben sind nur noch Steuervorteile aufgrund der Gemeinnützigkeit.
Auf die neue Wettbewerbssituation antworten die Freien Wohlfahrtsverbände mit Umstrukturierungen, wie beobachtet wird. In dem Bereich, in dem die Ökonomisierung am weitesten fortgeschritten ist, der ambulanten Pflege, hat zum Beispiel die Caritas mit Fusionen reagiert. Folge dieser stärker zentralisierten Organisation ist jedoch, dass gemeinwesenorientierte Ansätze verloren gehen. Ebenso gilt die Konzentration auf hauptamtliche und professionelle Kräfte als eine Folge der Ökonomisierung, wodurch die Bedeutung ehrenamtlichen Engagements abnimmt.
Da sich die Ökonomisierung nur in bestimmten Bereichen der Sozialen Dienste abzeichnet, die freien Träger aber ein größeres Spektrum abdecken, kommt es, so die Einschätzung, zu einer Spaltung der Organisationskultur und der Wertorientierungen innerhalb der Wohlfahrtsverbände. Unterschiedliche Finanzierungsmodi und Handlungslogiken liegen vor: Während die nicht kostendeckend finanzierten Aufgaben wie Beratungen oder Kindertagesstätten nach wie vor gemeindenah und dezentral geführt werden sollen, lautet die Anforderung an die schon ökonomisierten Zweige wie die Pflege, zentral organisiert bei möglichst effizientem Personaleinsatz zu agieren.
Aus der Sicht von Experten wird dieser Prozess letztlich zu einer Ausgliederung der wirtschaftlichen Tätigkeiten aus den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege führen, auch wenn die Wohlfahrtsverbände eine Aufteilung in einen karitativen und einen wettbewerblichen Bereich gerade nicht wünschen. Es wird befürchtet, dass der „karitative Rest“ nicht lebensfähig ist. Zum anderen geht die „ideelle Quersubventionierung“ verloren, die die Freien Wohlfahrtsverbände, insbesondere die kirchlichen, prägt.
Trotz anderer Wunschvorstellungen sind sich Vertreter der Freien Wohlfahrtspflege sicher, dass die Aufspaltung ihrer Verbände kommen wird. Für bedauernswert wird in diesem Zusammenhang gehalten, dass innerhalb der Verbände nicht konstruktiv damit umgegangen, sondern das Unvermeidliche nur unter heftigen Abwehrkämpfen zugelassen wird. Daher wird auch nicht der oft gewünschten Offenlegung der Finanzierungsmuster und Prägungen der einzelnen Aktivitäten der Freien Wohlfahrtspflege entsprochen. Dies treibt die bestehende Tendenz zur organisatorischen Aufspaltung nur weiter voran.
Folgen der ökonomisierung für private Anbieter Sozialer Dienste
Die privaten Anbieter beklagen zwar eine noch in Teilen bestehende Benachteiligung im Vergleich zu freien Trägern der Wohlfahrtspflege, sind aber optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung. Nach dem Motto „Der Markt wird es schon regeln“ setzen sie auf den zunehmenden Wettbewerb und wachsenden Kostendruck. Die Märkte können aus ihrer Sicht trotz der protektionistischen Abwehrversuche der Freien Wohlfahrtspflege nicht mehr abgeschottet werden. Man sollte vielmehr den Zugang für alle Anbieter eröffnen. Anbieter, die mangelhafte Qualität lieferen, können sich demnach sowieso nicht dauerhaft etablieren. Eine Regulierung gilt als nicht notwendig.
Folgen der Ökonomisierung für die Nutzer
Aus der Perspektive der Nutzer ist die Ökonomisierung zu begrüßen. Sie rechnen aufgrund des Wettbewerbs mit flexibleren und vielfältigeren Angeboten der Sozialen Dienste. Allerdings wird die Gefahr gesehen, dass insbesondere im Altenpflegebereich zu wenig moderne Konzepte der Altenhilfe, wie betreute Wohngruppen, die zugleich medizinische Versorgung gewährleisten, realisiert werden. Hier wird eine Steuerung auf kommunaler Ebene unter Einbeziehung der ansässigen (potentiellen) Nutzer für wünschenswert gehalten.
Als grundsätzlich notwendig gilt eine stärkere Ein- und Rückbindung der Sozialen Dienste an die Bürgergesellschaft. Das Zukunftsmodell Sozialer Dienste liegt demzufolge in der verstärkten Kopplung an den Stadtteil. Das hieße, zum Beispiel in Altenheimen nur noch den Rahmen anzubieten und auf eine Verknüpfung mit Angeboten im Stadtteil zu setzen. Dadurch ließen sich solidaritätsstiftende Arrangements gründen.
Zudem wird die Selbstinitiative der (zukünftigen) Nutzer Sozialer Dienste als wichtiger angesehen. Der oben angesprochene Wohlfahrtsmix sollte, so eine Forderung, ergänzt werden um einen vierten Bereich, nämlich den informellen, bestehend aus Angehörigen, Selbsthilfeorganisationen und Gruppen bürgerschaftlichen Engagements.
Fazit
Der schon bestehende Wohlfahrtsmix, der neben den traditionellen Anbietern Sozialer Dienste - den Kommunen und der Freien Wohlfahrtspflege - nun auch privat-gewerbliche Träger einbezieht, wird sich in Zukunft noch mehr diversifizieren und verstärkt kleinere Selbsthilfeorganisationen, engagierte Mitbürger und ähnlichen Gruppierungen aufweisen. Zudem wird davon ausgegangen, dass sich die Gewichte innerhalb der Mischung immer wieder verschieben werden. Hier werden Prozesse der Marktregulierung ihren Einfluss beweisen. Alle Akteure müssen sich an die teilweise neuen Rahmenbedingungen im Bereich Sozialer Dienstleistungen anpassen und versuchen, durch ihr spezifisches Vermögen und Angebot ihr bisheriges Gewicht zu vergrößern oder zumindest zu erhalten. Für die (potentiellen) Nutzer besteht die Aufgabe darin, einen stärkeren Einfluss sowohl auf die durch die öffentliche Hand vorgegebenen Rahmenbedingungen als auch auf die bereitstehende Angebotspalette zu gewinnen. Die Aussage eines Experten spricht, mit Blick auf die bestehenden Verhältnisse in der Altenpflege, genau diesen Wunsch aus: „So will ich nicht alt werden!“
Um einen Wohlfahrtsmix zu erzeugen, der den Bedürfnissen aller Beteiligten und Betroffenen gerecht wird, soll aber nicht nur auf Prozesse der Marktregulierung gesetzt werden, sondern analog zum Wohlfahrtsmix ist ein Steuerungsmix anzustreben. Neben dem Land und insbesondere der Kommune sollen hier partizipativ orientierte Vor-Ort-Gremien, bürgerschaftliche Initiativen sowie die schon angesprochenen Marktprozesse eine Rolle spielen.
Schwierig ist, dass diese idealisierte Wunschvorstellung des Steuerungsmixes im Gegensatz steht zu den Prozessen, die die Ökonomisierung der Sozialen Dienste mit sich bringt. Die gewünschte Steuerung vor Ort, möglichst kleinteilig, etwa auf Stadtteilebene, steht im Widerspruch zur Tendenz zu Fusionen und Zentralisierungen, die die großen Träger der Wohlfahrtspflege im Rahmen ihrer Strukturanpassung verfolgen. Auch sind die von privaten Trägern verfolgten renditeorientierten Projekte eben gerade nicht die dezentral und partizipativ ausgerichteten Ansätze.
Auch wenn die Ökonomisierung zu einem vielfältigeren Angebot führt, ist für die heutigen oder späteren Nutzer Sozialer Dienste nicht gesichert, dass dieses Angebot auch ihren Präferenzen entspricht. Die Ausfüllung des vierten, informellen Bereichs im Wohlfahrts- und Steuerungsmix und damit die Einflussnahme auf die anderen Akteure erscheint daher entscheidend. Wer sagt: „So möchte ich nicht alt werden“, sollte die Chance haben, durch Engagement einzuwirken auf die Art der angebotenen Altenpflege.
Die Autorin: Dr. Kirsten Mensch ist Politikwissenschaftlerin und seit 2000 Wissenschaftliche Referentin der Schader-Stiftung.

